We would like to entertain you
We are here that you have fun
We would like to make you happy
For the moment for tonight
At the end of comedy
At the end of tragedy
At the end of misery
At the end of history…

Der Himmel steht in Flammen, wenn Boris Kovač Saxophon spielt. Ein Gigant, der biegsam und elastisch wie ein Flummi bleibt. Ein kluger, alter Koloss an Kreativität und Hingabe, der sein kleines Orchester in seinen eigenen Rausch mitzerrt und trunken an dionysischer Leichtigkeit mit emotionalen Siebenmeilenstiefeln Abgründe und Höhenflüge des menschlichen Geistes auslotet. Mit der Doppeledition »The Last Balkan Tango« (2001) bzw. »Ballades At The End Of Time« (2003) hat er mit dem Ladaaba Orchest zwei Meisterwerke geschaffen, die in ihrer Intensität und Vielschichtigkeit wenig Vergleiche zu anderen musikalischen Experimenten des Balkans der letzten Jahre zulassen.
Das neueste Werk spinnt sich weiter um Kovač’ zentrale Frage, was nach der (blutigen) Geschichte der Menschheit übrig bleibt. »La Campanella« heißt das Projekt, und besagtes Album, »World After History«, treibt diese Idee zu ihrer musikalischen Perfektion. Hinzugekommen sind Momente der Ruhe und der Meditation, die ihren Atem aus den besuchten Plätzen einer mediterran-pannonischen Reise um den Balkan ziehen. Ein Sammelsurium an bestechend beschwingten Ideen und Klanggeheimnissen breitet sich vor uns aus, das aus der Feder eines Menschen mit Geschichte eine eigene, neue Geschichte kreiert, die den zweifelhaften letzten Abend der Menschheit, an dem selbstverständlich getanzt wurde, überschritten hat. Boris Kovač’ Geschichte ist eine produktive Kondensation aus Theater und Musik, aus Jazz und Folk, aus Trauer und Freude, die erzählt, was möglich wäre, wenn wir hinter uns lassen, was hinter uns ist.
Du hast das Interzone-Festival in Novi Sad gegründet. Was war Interzone, und was ist Interzone heute?
Interzone war eine Idee von mir von vor etwa zehn Jahren. In den 80ern war Novi Sad ein wichtiges Zentrum neuer Musik. Als 1991 alles stoppte, gingen alle Leute, die diese Szene erschaffen haben, ins Ausland, und die meisten kamen nicht zurück. Als ich nach fünf Jahren der Immigration zurückkehrte, war mir klar, dass diese Szene wiederaufgebaut gehört, und obwohl ich mich nicht als Animator sehen wollte, war mir klar, dass wenn ich es nicht tue, es niemand tun wird.
Interzone ist ein Festival für jede Art der neuen Musik, wo wir uns nach neuen Arten aktueller Musik umsehen, ohne Genre-Grenzen wirken zu lassen. Selbstverständlich stand das alles finanziell auf sehr dünnem Eis, weswegen der jährliche Rhythmus hin und wieder unterbrochen werden musste. Vor zwei Jahren war ich das letzte Mal Mitorganisator, danach habe ich diese Rolle jüngeren Leuten überlassen, die sie besser erfüllen können.
Welchen Einfluss hatte Interzone auf die Avantgarde-Szene in Serbien?
Ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss hatte, weil die generelle Situation für kulturelle Aktivitäten sehr schlecht ist. Natürlich war es für manche junge Menschen aus diesem Umfeld eine große Hilfe. Aber 200 Personen können nicht die kulturelle Situation eines Landes ändern.
Warum bist du 1996 nach Jugoslawien zurückgekehrt? Wäre es nicht leichter gewesen, im Ausland zu bleiben?
Ja, an sich schon. Das Land, in das ich zurückkam, steckte bis zum Hals in Problemen, aber auf der anderen Seite bereue ich diese Entscheidung gar nicht. Diese Erfahrung hat mir neue Ängste gezeigt, Ängste, die ich sonst nicht erfahren hätte. Ängste, die du niemandem wünschst. Und diese Ängste haben mich reicher gemacht.
Du bist auch ein Multimedia-Künstler. Wie sehen deine Projekte im Allgemeinen aus?
Ich arbeitete viel mit Theater, und jede meiner Arbeiten hat ein theatralisches Element. Meine Projekte haben meistens vielschichtige Konzepte, weil ich nicht im strengeren Sinne Musiker bin, sondern Musik nur eine von vielen Sprachen ist, die ich bediene, um Effekte zu erzeugen.
Kannst du dich irgendwie in Begriffen wie »Weltmusik« oder »ethnische Musik« wiederfinden?
Nein, leider ist es mir nie gelungen mein Werk zu kategorisieren, was besonders für die Vermarktung problematisch ist, da jedes Produkt seine Schublade braucht. (lacht) Ich mische immer viele verschiedene Einflüsse und sehe Musik als etwas Totales an. Aber ich benutze gewisse Musikformen, die als Neue Kammermusik oder New Jazz erkannt werden können. In den letzten paar Jahren war ich besonders in Weltmusik involviert, da mein letztes Projekt, das Ladaaba Orchest, aus der Szene kam. Aber an sich tue ich mir schwer etwas zu schaffen, was rein in einer Kategorie bleibt…
… was es so schwierig macht, deine Musik anderen zu beschreiben…
...ja, was auch davon lebt, dass ich nur akustische Instrumente verwende. Die geben eine gewisse Fähigkeit, ins Detail zu gehen, feine Elemente zu finden, die ganz besondere Gefühle und Ideen ausdrücken. Das ist der Punkt.
La Campanella vereint klassische Musik, Jazz, auch Folk-Elemente, die aber von sehr vielen unterschiedlichen Folk-Traditionen gefärbt sind. Also nicht nur die fünf oder sechs, die mir am nahesten stehen, sondern auch teilweise sehr spezifische Elemente, wie Vlaškische Musik. In einer gewissen Phase meines Lebens habe ich was Bestimmtes zu sagen, und dann suche ich nach den besten Mitteln, nach der besten Sprache um das auszudrücken. In der letzten Zeit hatte das zum Beispiel auch viel mit Tanzmusik zu tun, Standardtänze…
… »The Last Balkan Tango«.
Ja, genau, aber nicht, weil ich Tango so besonders mag, oder andere Standardtänze, sondern weil ich denke, dass die Leute heutzutage bewegt werden müssen, körperlich und emotional. Das wichtigste war eben immer das Gefühl in Bewegung zu bringen, weil es mir scheint, als ob sie in der letzten Zeit mehr denn je fehlen würden. Ich denke, es ist die Zeit der fehlenden Gefühle.
Alexandar Tišma, einer der bekanntesten serbischen Autoren, ist letztes Jahr verstorben. Hattest du Kontakt zu ihm? Wie wichtig war Tišma für Kovač?
Ich kannte Tišma, wir hatten freundschaftlichen Kontakt, und ich mag seine Arbeit, selbstverständlich. Er hatte auch einen sehr speziellen Zugang zur Frage nach dem Schicksal der menschlichen Geschichte, wobei mein Blick mehr – sagen wir – tragischer war als seiner. Manche seiner Werke kann ich nicht lesen, weil sie einen zu realistischen Blick auf die Geschichte zeigen. Und ich versuche dauernd die Geschichte zu überwinden.
Geschichte überwinden. Mit dieser schweren Last auf den Schultern zaubert dieser Herr Tangos und Walzer auf das Parkett der musikalischen Weltkarte (die diesmal gar bis Argentinien reicht), wie sie leichtfüßiger nicht sein könnten. Als Reiseführer, als einsamer Grenzgänger, als Arrangeur von außerordentlich unüberladenem Format liefert Boris Kovač den nötigen Soundtrack in eine bewegte, humorvolle Zukunft, die um die Schäden weiß, die die Menschen sich selbst und ihrer Umgebung antun können. Und der Balkan, aus dem Kovač seine Ideen nimmt, ist jenes tragische Beispiel, das die angesprochenen Ängste erklären kann. Aus dieser Verzweiflung hat er Musik geschaffen, die nirgends kategorisierbar die schönste Abrechnung mit dem Schrecken liefert. »World After History« ist eine Oper der Tanzwut und der Ekstase, die tausend Jahre und mehr umspannende Feuerwerke der Leidenschaft entfachen kann, wo sonst nur Dunkelheit regiert.
Was sind deine Lieblingsmusiker aus der zeitgenössischen Pop- und Rock-Musik?
(lacht) Ich habe mehr Kontakt zu solcher Musik über das Plattenregal meines Sohnes, vielleicht bin ich zu alt dafür. Ich mag Sting, als einen Großmeister, und aufgewachsen bin ich mit Sachen wie Van Der Graaf Generator. Das war eine Art Rockmusik, wie ich sie leider in den letzten 20, 30 Jahren nicht gefunden habe.
Und wie steht’s mit Improvisation?
Zu Beginn meiner Karriere war das eine sehr wichtige Sache, vor allem in den frühen 80ern, da war ich auch großer ECM-Fan, denn da war das alles richtig frisch und neu.
Die beste Kampfansage gegen die hier angesprochene, heutige Langeweile ist Boris Kovač selbst. Frisch und neu ist seine Welt nach der Geschichte. Und es lohnt sich, diese Welt auszukosten.
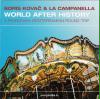
VÖ: 23.05.2005 auf
Piranha
INFO:
www.boriskovac.com
 Jeder mir bekannte Live-Mitschnitt eines Arcade Fire-Konzerts der letzten Mai-Tour hatte neben den jedem und jeder im Saal bekannten Songs von »Funeral« auch mindestens zwei weitere Songs, die die rätselhaften Namen »Old Flame« und »No Cars Go« trugen. Auch in Wien war es nicht anders, und die angesprochene, von Arcade Fire 2003 in einem Schuppen zu Demozwecken selbst produzierte EP war wenige Minuten nach Konzertende ausverkauft. Es blieb ein schales, ungewisses Fragezeichen, da waren also diese Songs, die aus einem anderen Universum als »Funeral« kamen, einen gänzlich anderen Status hatten als der Wahnsinn, den »Funeral« auf sich vereinte. Neben der unfassbaren Live-Performance des Kollektivs aus Kanada war diese kleine Scheibe das Einzige, das uns beweisen konnte, dass »Funeral« keine Eintagsfliege ist, sondern dass diese Band auch mehr als ein Album auf dem Niveau verbringen kann.
Jeder mir bekannte Live-Mitschnitt eines Arcade Fire-Konzerts der letzten Mai-Tour hatte neben den jedem und jeder im Saal bekannten Songs von »Funeral« auch mindestens zwei weitere Songs, die die rätselhaften Namen »Old Flame« und »No Cars Go« trugen. Auch in Wien war es nicht anders, und die angesprochene, von Arcade Fire 2003 in einem Schuppen zu Demozwecken selbst produzierte EP war wenige Minuten nach Konzertende ausverkauft. Es blieb ein schales, ungewisses Fragezeichen, da waren also diese Songs, die aus einem anderen Universum als »Funeral« kamen, einen gänzlich anderen Status hatten als der Wahnsinn, den »Funeral« auf sich vereinte. Neben der unfassbaren Live-Performance des Kollektivs aus Kanada war diese kleine Scheibe das Einzige, das uns beweisen konnte, dass »Funeral« keine Eintagsfliege ist, sondern dass diese Band auch mehr als ein Album auf dem Niveau verbringen kann.


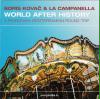


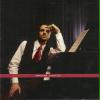

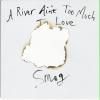



.gif)


